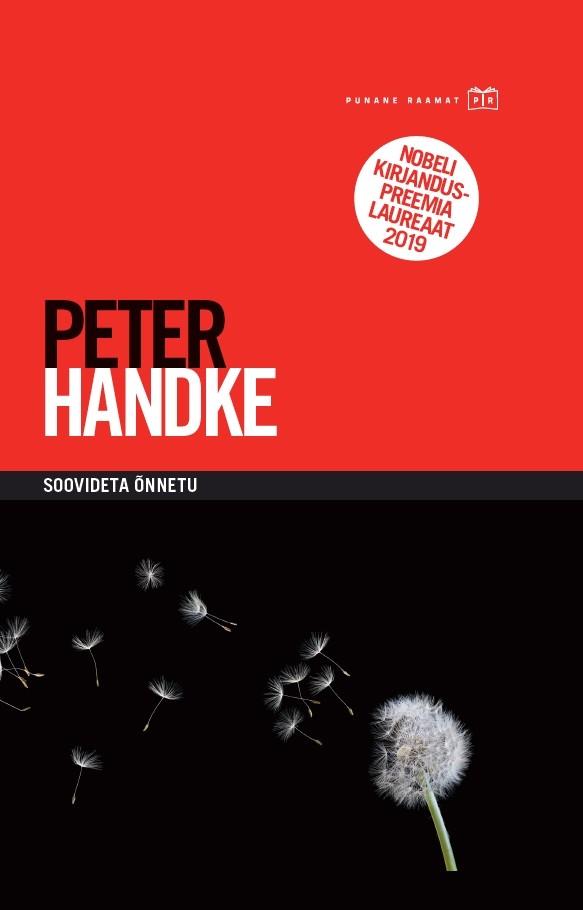(Peter Handke "Soovideta õnnetu", Tallinn: Varrak, übersetzt von Eve Sooneste)
Die Besprechung erschien zunächst auf Estnisch in der Kulturzeitung Sirp (2.05.2020). Hier ins Deutsche übersetzt von Cornelius Hasselblatt.
Warum soll man in diesem unvergesslichen Pandemiefrühling 2020 den 1972 erschienenen Kurzroman „Wunschloses Unglück“ des damals 29jährigen Peter Handke (Literaturnobelpreisträger von 2019), der gerade in estnischer Übersetzung erschienen ist, lesen?
Hauptsächlich deswegen, weil es sich hier um eine umgekehrte Geschichte handelt, bei der vom Standpunkt der geistigen Gesundheit des Menschen betrachtet das Milieu, in dem man Tag für Tag lebt, und die Gewohnheiten, deren Sklave man ist, bestimmend sind. Und es geht auch darum, wie entscheidend es für einen Menschen ist, sich selbst kennenzulernen und zu wissen, wer man ist. Und diese Themen sind momentan aktueller denn je, da es sich für viele als Prüfung erwiesen hat, plötzlich alleine mit sich selbst zu sein oder mit seiner Familie zusammenzuhocken.
Sich selbst kennenzulernen ist keineswegs selbstverständlich. Glücklich sind die, die sich selbst erkannt haben: Darunter verstehe ich die Selbsterkenntnis hinsichtlich der eigenen Berufung, aber auch des eigenen Wesens. In Wirklichkeit sind die Menschen nicht – das waren sie vor 50 oder 70 Jahren nicht und das sind sie heute nicht – besonders geschickt, wenn es darum geht, die innere Landschaft ihrer Seele kennenzulernen und zu ergründen. Das ist auch verständlich, weil es dazu keinen guten Rahmen und keine guten Anleitungen gibt (sei es zuhause oder in der Schule). Aber gerade der Umstand, dass man sich selbst, sein Wesen und seine Bedürfnisse und Wünsche nicht kennt, kann einen Menschen unendlich unglücklich machen.
Unendlich und wunschlos unglücklich sind auch Subjekt und Mittelpunkt von Handkes Kurzroman – irgendwie gelingt es mir nicht, die Frau, um die es im Roman geht, als handelnde Person zu bezeichnen. „Wunschloses Unglück“ (1972) ist nämlich ein Buch über Handkes Mutter und ihr Leben, das sie 51jährig mit ihrem Selbstmord in einer österreichischen Kleinstadt beendet. Handke fängt sieben Wochen nach dem Tod der Mutter mit dem Schreiben an, mit anderen Worten in dem Moment, als die Erholung vom Selbstmord der Mutter sich in „stumpfsinnige Sprachlosigkeit“ (S. 7) zu verwandeln droht, während gleichzeitig der Wunsch zu schreiben nicht mehr überbordend zwingend und drängend ist.
Ende 1971 und Anfang 1972, als dieses Buch niedergeschrieben wurde und der Fall mit Handkes Mutter stattfand – ich verwende hier bewusst dieses Wort, denn auch Handke selbst schreibt, dass in ihm ein merkwürdiger Wunsch brennt, seine Mutter als einen Fall zu behandeln –, war Handke bereits ein anerkannter österreichischer Autor. Von ihm waren Romane und Gedichte erschienen, seine Werke wurden inszeniert und im Radio gesendet, eine seiner Erzählungen wurden gerade verfilmt… Im November 1971, als seine Mutter beschloss, aus dem Leben zu scheiden, arbeitete Handke in seinem Haus in Kronberg in Deutschland an einer Erzählung, die später den Titel „Der kurze Brief zum langen Abschied“ bekommen sollte.
Handke war sich also des suizidalen Wesens seiner Mutter bewusst, er hatte sich auch bemüht, sie auf die fröhlichere Seite des Lebens zu lotsen, doch ergebnislos. Die Enttäuschung der Mutter vom Leben, das, was sie durchgemacht hat, und die Unfähigkeit, Alternativen zum Vorhandenen zu sehen, verbieten ihr, sich aus ihrer Apathie zu befreien, und wohl auch aus ihrer Wut oder ihrem Schmerz über eben diese Apathie. Die Biografie von Handkes Mutter scheint charakteristisch zu sein für die ländliche katholische Gesellschaft Österreichs vor und nach dem Zweiten Weltkrieg. Auch im Klappentext des Buchs wird immer das Porträt der damaligen österreichischen Gesellschaft erwähnt. Aber wenn man darüber nachdenkt, ist in jener Umgebung, die Handke beschreibt, sehr viel universelles, das auch anderswo und zu anderen Zeiten Gültigkeit hat.
Die Gesellschaft, von der in diesem Kurzroman die Rede ist und die das Subjekt dieser Geschichte umgibt, widmet sich Dingen – nicht Menschen und ihrer Gefühlswelt. Über Gefühle vermag man nicht zu sprechen. In Ehren gehalten wird die Arbeit, und der Alltag ist eher um Gegenstände herum strukturiert als um Menschen. Handke konstatiert, dass es die Zeit ist, in der Eigentum Freiheit bedeutet.
Denken und eine mit Gefühlen verbundene Tätigkeit (geringschätzend Faulenzen genannt) haben in dieser Gesellschaft keinen Platz. Und irgendwie kann man das den Menschen auf dem Lande und dieser Zeit nicht vorwerfen. Das Problem besteht darin, dass Handkes Mutter von ihrem Wesen her anders ist: Sie ist schöpferisch und spielerisch, sie interessiert sich fürs Lernen und ist wissbegierig. Sie hat jedoch nicht den richtigen Bezugsrahmen und die Menschen um sich gehabt, mit deren Hilfe sie sich selbst hätte begreifen können, einen Kontext, in dem sie sich hätte positionieren können. In ihrem Leben hat es zwar Momente gegeben, in denen sie sich gefühlt hat (S. 20) oder anfing, sich selbst wahrzunehmen (S. 72), aber sie hat keine Art und Weisen gefunden, die sie in ihrem Selbstsein unterstützt hätten. In gewisser Hinsicht ist es die Geschichte von einem Leben ohne sich selbst.
Handke ruft, aber nicht auf aufdringlich vorwurfsvolle Art, die Momente der Mutter in Erinnerung, in denen sie ohne sich selbst war, und wie sie sich selbst verlor. „Ein lächerliches Schluchzen in der Toilette aus meiner Kindheit her, ein Schneuzen, rote Hasenaugen. Sie war; sie wurde; sie wurde nichts.“ (S. 44). Hier ist die Mutter Opfer, aber das ist nicht durchgängig im Roman der Fall. Handke führt Momente an, in denen die Mutter handelt, die Zügel in die Hand nimmt und sich nicht von den Umständen unterkriegen lässt. Ganz sicher stellt Handke seine Mutter nicht durch und durch passiv dar. Er beobachtet, wie seine Mutter sie selbst wird, sich ihrer selbst bewusst wird, aber auch, wie sie dem Leben unterliegt, ihr Unvermögen, die Umstände ihres Lebens so zu ändern, dass das Leben lebenswert wäre.
Bei dieser Beschreibung hat Handke gekonnt vermieden, in die Falle zu geraten, andere zu beschuldigen. Er lässt den Leser wohl einen Blick auf das Zusammenleben von seinem Stiefvater und seiner Mutter werfen, das nicht funktioniert, er lässt die Gewalt des Alltags sehen, die gegenseitige Erniedrigung und den unbeholfenen Sex, macht den Gatten der Mutter, ungeachtet des Trinkens, der Passivität und des Desinteresses, aber nicht für das Leben seiner Mutter verantwortlich.
Handkes Fähigkeit, nicht zu urteilen, sondern zwischen Anteilnahme, Ehrlichkeit und der Opferposition zu balancieren, ist bewundernswert. Der Kurzroman „Wunschloses Unglück“ ist beschrieben worden als ein Wendepunkt in Handkes Werk, seiner eigenen Meinung nach steht er außerhalb von allem anderen, was er geschrieben hat. Es ist tatsächlich ein persönliches Buch, geboren aus dem Bedürfnis eines schreibenden Menschen heraus, sich in „sprachlosen Schrecksekunden“ (S. 47) nicht lähmen zu lassen, sondern aus ihnen auszubrechen und sie zu überwinden.
Der Roman ist tatsächlich auch vom Standpunkt des Erzählens spannend, mit anderen Worten, was das Nachdenken über die Rolle der Sprache und ihrer Wirkungskraft betrifft. Handke weiß nur allzu gut, und er lässt auch den Leser daran teilhaben, wie leicht es beim Erzählen ist, aus einem Individuum einen sogenannten Fall zu machen, den man untersuchen und analysieren kann.
„Ich vergleiche also den allgemeinen Formelvorrat für die Biografie eines Frauenlebens satzweise mit dem besonderen Leben meiner Mutter; aus den Übereinstimmungen und Widersprüchlichkeiten ergibt sich dann die eigentliche Schreibtätigkeit.“ (S. 45–46).
Er wägt während des Schreibens sorgfältig jedes Wort und jede Formulierung ab. Er will seine Mutter nicht zu einer Romanfigur machen, die man aus der Distanz betrachtet:
„Diese zwei Gefahren – einmal das bloße Nacherzählen, dann das schmerzlose Verschwinden einer Person in poetischen Sätzen – verlangsamen das Schreiben, weil ich fürchte, mit jedem Satz aus dem Gleichgewicht zu kommen.“ (S. 44–45)
Deswegen konnte Handke das Buch nicht wie einen gewöhnlichen Roman schreiben – auch wenn es entsprechend den Gepflogenheiten des deutschen Literaturbetriebs als Kurzroman tituliert worden ist. Er konnte sich selbst nicht aus dem Schreibprozess ausklammern oder auf die Position des bloßen Erzählers reduzieren, er musste anwesend sein, ein Teil der Geschichte werden und auch seine Gefühle, seine Sprachlosigkeit und seine Ängste Teil der Geschichte der Mutter werden lassen.
„Eine andere Eigenart dieser Geschichte: ich entferne mich nicht, wie es sonst in der Regel passiert, von Satz zu Satz mehr aus dem Innenleben der beschriebenen Gestalten und betrachte sie am Ende befreit und in heiterer Feierstimmung von außen, als endlich eingekapselte Insekten – sondern versuche mich mit gleichbleibendem starren Ernst an jemanden heranzuschreiben, den ich doch mit keinem Satz ganz fassen kann, so daß ich immer wieder neu anfangen muß und nicht zu der üblichen abgeklärten Vogelperspektive komme.“ (S. 46).
Handke räumt ein, dass ein letztliches Begreifen seiner Mutter und ihrer Tat für ihn unerreichbar bleibt, und doch versucht er zu verstehen, versucht, sich an sie heranzuschreiben, ohne sie mit Etiketten zu belegen und zu beschuldigen. Vielleicht ist „Wunschloses Unglück“ auch der Versuch, die Mutter und die sie umgebende Welt zu begreifen und zu berücksichtigen, wozu ja auch Handkes eigene Kindheits- und Jugendwelt zählt, sich aber gleichzeitig in gewisser Hinsicht auch davon frei oder los zu schreiben.
Neben der Geschichte der österreichischen ländlichen Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg ist es doch in erster Linie ein Buch über die Kompliziertheit, sich selbst kennenzulernen, sowohl vom Standpunkt von Handkes Reflexionen als auch der Sinngebung der Geschichte seiner Mutter. Diese Einsicht ist nicht nur thematisch aktuell und mitreißend, sondern auch ein Genuss sowie sprachlich und poetisch bereichernd.